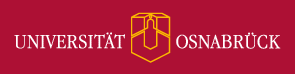Hauptinhalt
Topinformationen
Allgegenwärtig versteckt: Homosexualität in und um Osnabrück vor 1969
Die Unsichtbarkeit von Homosexualität wurde viel stärker in Familien als in Gerichtssälen produziert. Unsere Interviews mit Personen, die vor 1969 erste sexuelle Kontakte hatten, verdeutlichen allesamt, wie stark das klassische Familienmodell ihre Selbstwahrnehmung prägte.
Tradierte familiäre Erwartungen
Mitte der 1960er Jahre wurde der damals um die 20 Jahre alte Lennard Germroth* immer wieder gefragt:
„‚Hast du noch keine Freundin?‘ […] Aber meine Eltern sind noch nie auf die Idee gekommen, dass ich andere Gedanken haben könnte. [...] Es hat mich aber nie jemand gefragt. […] Und hab ich dann meine Frau kennengelernt, an einem Samstagabend. Und am Sonntag war für mich schon klar, wenn du überhaupt mal heiratest, dann ist das die, weil es war dann schon Liebe da. Und so ist es dann auch gekommen.“ (Projektarchiv VHM, Interview P24)
Die Erwartung eine Familie aufzubauen prägte insbesondere Frauen. Fast alle Interviewpartnerinnen dieser Generation führten zunächst eine heterosexuelle Ehe. Beispielhaft erinnert sich die Anfang der 1930er Jahre geborene Stefanie Bruckmann*, sie habe „später eben erstmal geheiratet, weil ich dachte, dann geht das [lesbische Empfinden] auch vorüber, ne. Ja und es ging eben – zwölf Jahre war es ungefähr – ja es ist auch nicht vorüber gegangen.“ (Projektarchiv VHM, Interview P2_3)
Bundesverfassungsgericht 1957, Wiedergabe des Gutachtens von Prof. R. Gasberger
Nach seinen Erfahrungen seien die Männer in der Aggressivität und somit in der sozialen Gefährlichkeit den Frauen weit überlegen. Die von ihnen ausgehende Gefahr einer Verführung sei wesentlich größer als bei den Lesbierinnen. [...] Die im jugendlichen Alter bestehende Gefahr der Fehlprägung sei bei der weiblichen Homosexualität weit geringer. Häufigerweise zeige sich die Frau der Verführung zur gleichgeschlechtlichen Unzucht erst dann zugänglich, wenn sie in ihrem Eheleben Schiffbruch erlitten habe.
Entsprechend blickt auch Annette Söller* zurück auf diese Generation, in der „quasi alle lesbischen Frauen […] noch ne Zwischenepisode, ne heterosexuelle hatten, wo sie verheiratet waren, einige haben Kinder gekriegt, einige nicht.“ (Projektarchiv VHM, Interview P7) Auch ökonomische Gründe sprachen für eine Heirat. Lennard Germroth* erbte einen Hof und so forderte nicht nur sein Lebensumfeld, sondern auch sein Arbeitsalltag eine Partnerschaft, die nur eine Frau sein konnte: „Ich bin einfach schwul gewesen“, resümiert er trocken, „aber ich hab ne Frau gebraucht und hab sie auch gerne gemocht. Und wir haben tolle Reisen gemacht, es war auch ne schöne Zeit. Sie hat es natürlich nicht gewusst, was in meinem Inneren los war.“ (Projektarchiv VHM, Interview P24).
Paradoxerweise schuf die herrschende Sexualmoral, die Frauen wie im Bundesverfassungsgerichtsurteil zum §175 im Jahr 1957 sexuelles Begehren weitgehend absprach, größere Freiräume für Frauen, da lesbische Liebe noch weniger als schwule erwartet wurde. Stefanie Bruckmann* resümiert, viele Betrachter hätten gedacht, „wenn Frauen zusammen sind, dann: ‚Ach, das ist doch nur so ein Spiel da, ne?‘ Ich denke, das wurde nicht ernst genommen.“ Ihre damals bereits in lesbischen Beziehungen lebende heutige Partnerin hält dem jedoch entgegen, ein Teil der Unsichtbarkeit lesbischer Liebe
„lag an den Frauen selber. Also diese äh Tanten, muss ich ja sagen, oder Großtanten oder was das war, äh, die hätten ja selber das auch mal ‚Wir lieben uns!‘, ne, ‚Wir sind füreinander da‘, ‚Wir tragen Verantwortung füreinander‘, […] ‚für uns ist das sowas wie eine Ehe‘, hätten die doch mal sagen können. […] Aber das war nicht denkbar so etwas. Nicht mal denkbar in der Zeit. (Projektarchiv VHM, Interview P2_P3)
Die stille Präsenz des §175
Doch trotz der eher indirekten Präsenz des §175 war dieser für Lesben und Schwule allgegenwärtig. In den Interviews fällt dabei ein Unterschied in der Wahrnehmung lesbischer und schwuler Personen auf. Beispielhaft für lesbische Frauen berichtet Stefanie Bruckmann*, dass der §175 allseits bekannt war, aber eben nur Männer betraf:
„Ja erfahren haben wir ja ganz früh davon [dem §175]. Weil wir ja wussten, dass mit den Männern so viel Schlimmes passierte, ne. Das haben wir frühzeitig gemerkt.“ (Projektarchiv VHM, Interview P2_3)
Anders hingegen gleich alte interviewte schwule Männer, von denen wohlgemerkt keiner nach §175 angeklagt oder verurteilt wurde. Er wird in den narrativen Teilen der Interviews kaum erwähnt und auch auf Nachfrage eher marginal behandelt. Beispielhaft ein Gesprächsauszug aus den letzten Minuten des ausführlichen Interviews mit Lennard Germroth*, der im Interview sehr offen und reflektiert über seine Erlebnisse sprach:
I: Hat denn zu irgendeinem Zeitpunkt in Ihrem Leben der §175 über…
B: ...ich wusste, dass es den gab, aber der war nicht wichtig für mich.
I: Hhm.
B: Also wann ist der abgeschafft worden? Ich weiß es nicht.
Schon zu Schulzeiten wurde zwar „ja auch gesagt du bist 175er, ne, und so“, aber dies habe immer andere getroffen, nicht ihn selbst. In solchen Fällen habe er dann eine tolerante Position eingenommen:
Es werden ja immer und überall, über die Ostfriesen und alles, werden ja Schwulen-Witze auch gemacht. Aber da bin ich zum Beispiel immer schon so gewesen; ich hab da nie mitgemacht. Ich hab auch drüber gelacht, aber ich habe die nie weiter ausgebaut oder irgendwelche, sondern hab da immer gesagt, lass sie doch. Manche waren ja so: ‚Ne, würde ich ja nie‘, oder ‚Was die alles machen‘ und so. Ich sag: ‚Lass sie doch. Du machst doch auch das was du willst.‘ (Projektarchiv VHM, Interview P24)
Die lange Wirkung nationalsozialistischer Normen
Die danach folgende Generation jüngerer Aktivisten führte ein solches Ausweichen, was ja aus konkreten Lebensumständen und einer entsprechenden Umwelt erwuchs, zu grundlegenden Fragen. So fragte sich der Anfang der 1960er Jahre geborenen Kurt Mühlenschulte* angesichts der Kontinuität rechtlicher Normen aus dem Nationalsozialismus:„Was hat dieser Paragraph eigentlich insgesamt eigentlich mit der Gesellschaft gemacht und hat er eine ganze Generation tatsächlich in die Situation getrieben, in so eine Geheimnistuerei? Hat er dazu geführt, dass sich diese Generationen eigentlich nicht in ihr Coming-Out gehen konnten?“ (Projektarchiv VHM, Interview P1).
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1957
Gleichgeschlechtliche Betätigung verstößt eindeutig gegen das Sittengesetz.
Dies bejaht Lennard Germroth* in der direkten Fortführung seiner weiter oben zitierten Ausführungen: „Also ich hab dann nie, ich hab mich zwar nie geoutet, aber ich hab dann auch nicht gegen meine Überzeugung geredet. Es wäre keiner auf die Idee gekommen, dass ich, dass ich schwul wär.“ (Projektarchiv VHM, Interview P24).
Recht verfolgte also weniger, als es effektiv verdrängte. Und indem Recht derart verdrängte, drängte es in Normen. Derart weitete sich die hinter dem §175 stehende Verfolgungspraxis des Nationalsozialismus auch auf Frauen aus, welche die konkrete Rechtslage der Bundesrepublik in anderer Art benachteiligte. Insbesondere (lesbische) Frauen waren von Unterhalts- und Sorgerechtsfragen im Falle der Trennung von ihrem Ehemann betroffen.
Weil die Zeit, ja gerade die Nachkriegszeit einfach, also ja, wenn ich überlege so, eben wie wir groß geworden sind, wie wir gelebt haben auch, auch mit meinen Eltern. Wie gesagt, Scheidungsrecht, Schuldprinzip, die war ja so heterosexuell geprägt, also wirklich so auf Familie und auf so was Normales eben, ne, was damals normal war. (Projektarchiv VHM, Interview Annette Söller*)
Somit verlieh weniger die justizielle Praxis, als vielmehr das stete Abtun von Homosexualität im Alltag Osnabrück den Anschein, eine Stadt zu sein, in der Homosexualität einfach keine Rolle spiele.
Fehlende Vorbilder
Diese Versuche, der Normierung der Sexualität durch den Rückzug ins Private zu begegnen, hinterließ bei der nachfolgenden Generation die Leerstelle komplett fehlender Vorbilder. Wie lernt man, eine homosexuelle Beziehung zu leben, wenn man sich an keiner anderen orientieren kann? Entsprechend werden Begegnungen gezeigter Homosexualität mit größten Respekt erinnert. Erwähnungen solcher seltenen Fälle vor 1969 kamen aber nur in Interviews mit Frauen vor. Die erste Generation schwuler Aktivisten in Osnabrück benennt keine solchen Vorbilderfahrungen; sei es, weil die Männer jener Generation ihre Homosexualität noch stärker versteckten, sei es aufgrund genderspezifischer Erinnerungsmodi. „Bedrückend“ bemerkt der Mitte der 1960er Jahre geborene Albert Leuck*, dass „diese Großväter-Generation“ fehle, oder allgemein „so Leute im Alltag, mit denen man sich so identifizieren kann oder mit denen man so über alte Zeiten sprechen kann.“
Ich kenn eigentlich niemanden, der mir jemals erzählt hätte: ‚Ich hab deswegen im Gefängnis gesessen oder ich war da bedroht, oder ich hab da extreme Angst vor gehabt.‘ Weil diese Leute einfach gar nicht vorhanden waren, so in der Szene und in der Bewegung. (Projektarchiv VHM, Interview P15).
Traten solche Personen hervor, waren sie „absolute Einzelfälle“ und sofort „Mega-Gallionsfiguren“. So können wir heute das Fehlen dieser „Älteren, die einfach so selbstverständlich da sind“ als die wohl beständigste Wirkung der Produktion von Unsichtbarkeit homosexuellen Lebens auch in Osnabrück sehen. Albert Leuck* vermisste diese Stimmen bereits in den 1980er Jahren und auch heute sieht er darin einen kulturellen Verlust:
Und da denk ich immer, ja, die müssen ja auch, die müssen ja auch irgendwo sein, die sind ja nicht alle tot. Aber ich glaube, die schweigen dann. Die schweigen einfach darüber, ne. […] Die sind […] nicht sichtbar oder erlebbar. Und da, da denk ich, da fehlt einfach..., da fehlt..., da fehlt was. (Projektarchiv VHM, Interview P15)
©VHM (2020)